Wer bei der Lachmöwe nur an sommerliche Küstenpromenaden und Fischbrötchen denkt, liegt daneben. Diese Möwe ist weit mehr als ein typischer Strandvogel. Sie ist auch im Binnenland heimisch und das ganze Jahr über zu entdecken. Sie ist eine der flexibelsten Möwenarten Europas und taucht auch dort auf, wo man sie am wenigsten erwartet.
Gerade weil sie so allgegenwärtig erscheint, wird sie oft unterschätzt. Dabei steckt hinter der Lachmöwe viel mehr, als ihr Name oder ihr Ruf vermuten lassen. Im Folgenden schauen wir genauer hin und räumen mit einigen hartnäckigen Mythen über diese vielseitige Möwe auf.
Wo lebt die Lachmöwe?
Auch wenn viele Menschen Möwen automatisch mit Küsten verbinden: Die Lachmöwe ist ursprünglich eine Binnenlandmöwe. Sie brütet bevorzugt an ruhigen Gewässern im Inland.
Ihr Verbreitungsgebiet ist ziemlich groß: Es reicht von Mitteleuropa über Russland bis nach Kamtschatka und in die andere Richtung über Irland und Island bis an die Küsten Neufundlands.
Bei uns in Mitteleuropa kannst du sie ganzjährig sehen. Andere Brutgebiete räumt sie komplett und überwintert rund ums Mittelmeer, in Afrika oder in Asien.
Lachmöwen brüten in Kolonien, die von wenigen Paaren bis zu über 20.000 Brutpaaren groß sein können. Da ist dann ganz schön was los, denn Lachmöwen sind sehr kommunikativ und ruffreudig. Die dichte Nachbarschaft hat viele Vorteile: Lachmöwen sind sehr gut darin, ihre Nester gemeinsam gegen Beutegreifer zu verteidigen. Davon profitieren auch andere Vogelarten wie Löffler oder Flamingos, die bewusst in ihrer Nähe brüten.
Von einer ganz besonderen Lachmöwenkolonie habe ich hier erzählt: Zwillbrocker Venn: Flamingo-Hotspot im Münsterland
Hast du Bock, eine Vogelart durch ein Jahr zu begleiten, und sie dabei so richtig gut kennenzulernen? Dann komm mit auf deine ganz persönliche Jahresvogel-Reise.

Woran erkennst du eine Lachmöwe?
Die Lachmöwe immer wiederzuerkennen, kann eine kleine Herausforderung sein. Sie verändert ihr Aussehen im Laufe ihres Lebens und im Laufe eines Jahres deutlich. Ein paar Merkmale bleiben aber immer gleich: Sie ist schlank, relativ zierlich, wirkt insgesamt „niedlicher“ als große Möwenarten und hat dunkle, runde Augen in einem runden Kopf.
Eine erwachsene Lachmöwe im Prachtkleid hat einen dunkel schokoladenbraunen, fast schwarzen Kopf, hellgraue Flügel mit schwarzen Rändern und rote Beine und einen roten Schnabel. Wie sich das für eine ordentliche Möwe gehört, ist ihr Gefieder ansonsten weiß.
Dieses Erscheinungsbild hat ihr im Englischen den Namen black-headed gull eingebracht.
Im Schlichtkleid verschwindet ihr typischstes Erkennungszeichen, die dunkle Kopfhaube, fast vollständig. Nur ein dunkler Fleck mit unscharfen Konturen hinter dem Auge bleibt zurück, ihr „Ohrfleck“. Daran kannst du sie auch außerhalb der Brutzeit gut erkennen.
Das Gefieder der Jungvögel ist gräulich-sandfarben gefärbt. Ihre Beine und Schnäbel sind noch zart rosa bis leicht orange.
Trotz ihrer Zierlichkeit bringt sie es auf eine Flügelspannweite von etwa einem Meter. Sie ist die kleinste der eigentlichen Möwen, die bei uns brüten und gehört damit nicht zu den sogenannten Großmöwen (wie zum Beispiel Silbermöwe, Heringsmöwe und Mantelmöwe).

Was fressen Lachmöwen?
Auch wenn das Klischee hartnäckig ist: Lachmöwen sind keine typischen Fischbrötchendiebinnen. Zu Pommes sagen sie aber nicht nein. Ihr natürlicher Speiseplan ist ausgesprochen vielfältig: Regenwürmer, Krebstiere, verschiedene Insekten, kleine Fische, Getreide und Pflanzensamen, kleine Wirbeltiere (lebend oder als Aas) und auch mal menschliche Abfälle.
Eine Studie, die mit Silbermöwen durchgeführt wurde (die aber bestimmt auch auf Lachmöwen übertragbar ist), hat gezeigt, dass Möwenküken immer Fisch bevorzugen, auch wenn sie mit menschlichem Essen aufgezogen wurden.

Warum heißt die Lachmöwe Lachmöwe?
Um den Namen der Lachmöwe rankt sich ein weit verbreiteter Mythos: Der Vogel heiße so, weil er an „Laaaachen“, also stehenden Gewässern, brüte. Das stimmt zwar als Lebensraumangabe, ist aber nicht der Ursprung ihres Namens.
Der Name ist viel direkter: Die Lachmöwe heißt Lachmöwe, weil ihre Rufe wie Lachen klingen.
Das spiegelt sich auch in ihren wissenschaftlichen Namen wider: Larus ridibundus oder inzwischen: Chroicocephalus ridibundus. Ridibundus heißt lachend. Lachenende Möwe also.
Diese lateinischen Namen stammen ursprünglich von Carl von Linnée und der war Schwede. Auch ihr schwedischer Name skrattmås bedeuted übersetzt ebenfalls „lachende Möwe“.

Unfreiwillige Pionierin der Verhaltensforschung.
Die Lachmöwe hat die Verhaltensbiologie maßgeblich geprägt – vor allem durch die Arbeiten von Nikolaas Tinbergen, der 1973 gemeinsam mit Konrad Lorenz und Karl von Frisch den Nobelpreis für Medizin dafür erhielt.
Tinbergen beobachtete etwas Merkwürdiges: Lachmöwen lassen die Schalen ihrer frisch geschlüpften Küken über eine Stunde lang im Nest liegen, bevor sie sie dann doch entsorgen. Warum?
Tinbergen machte dazu ein Experiment. Er malte Hühnereier in den Tarnfarben der Lachmöwen an, brach einige auf, andere ließ er ganz, und legte sie in die Brutkolonien. Er beobachtete, dass die weißen, offenliegenden Eierschalen fliegenden Beutegreifern wie Greifvögeln und Rabenvögeln schneller ins Auge fielen als die unbeschädigten, gut getarnten Eier.
Damit war Teil eins des Rätsels gelöst: Die Eierschalen müssen aus dem Nest verschwinden, weil sie sonst den Standort verraten und hungrige Beutegreifer direkt zu den Küken locken.
Gleichzeitig zeigte sich ein anderes Risiko: In den dichten Kolonien kommt es zu Kannibalismus – allerdings nur bei Küken mit nassem Flaum, die leichter zu schlucken sind. Trockene Küken werden kaum gefressen, weil sie nicht so gut den Hals hinunterglitschen.
Damit stehen die Eltern vor einem Dilemma:
- Räumen sie die Schalen sofort weg, dann steigt für das frisch geschlüpfte Küken das Risiko von einer Lachmöwe gefressen zu werden.
- Warten die Eltern zu lange, steigt die Gefahr, dass Beutegreifer das Nest entdecken.
Tinbergens Beobachtungen zeigten: Die Gefahr durch kannibalistische Nachbarn ist in den ersten Minuten nach dem Schlupf viel größer als die Gefahr durch Beutegreifer. Also entscheiden sich die Lachmöweneltern für den Mittelweg. Sie warten, bis der Flaum ihres Kükens trocken ist. Das dauert etwa eine Stunde. Und erst dann räumen sie die Schalen weg.
Eine erstaunlich Balance zwischen Tarnung, Timing und knallhartem Möwenalltag. Genau die Art von Verhalten, die zeigt, wie faszinierend die Welt der Vögel ist. Und was sich noch alles offenbart, wenn man ein bisschen näher hinschaut.

Bestandsachterbahn der Lachmöwe
Und obwohl sie so flexibel sind, ist ihr Bestand den letzten 200 Jahren ganz schön Achterbahn gefahren.
Im 19. Jahrhundert sah es für sie erst einmal düster aus: Feuchtgebiete wurden trockengelegt, Flüsse begradigt, und die Möwen selbst wurden verfolgt. Die Folge waren dramatische Einbrüche. Doch gegen Ende des Jahrhunderts drehte sich der Trend. In ganz Europa breiteten sich Lachmöwen wieder aus, eroberten neue Regionen und gründeten Kolonien sogar an Orten, an denen sie vorher nie vorkamen. Gleichzeitig drängten sie sich in Deutschland immer stärker in die letzten verbliebenen Feuchtgebiete und an die Küsten.
Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ging es für die Art steil bergauf. Die Kolonien wuchsen rasant, manche Länder verzeichneten richtige Lachmöwenbooms. In den 1970er und 1980er Jahren erreichten die Bestände an vielen Orten ihren Höhepunkt. Doch der Höhenflug hielt nicht an.
Seit den 1990ern zeigt die Kurve regional wieder deutlich nach unten. In Deutschland sank der Gesamtbestand zwischen 1988 und 1999 um mehr als 25 Prozent. Manche Kolonien schrumpften langsam, andere brachen fast über Nacht ein.
Dafür gibt es mehrere Gründe: verschwundene oder stark veränderte Feuchtgebiete, verarmte Schilfzonen, weniger Nahrung für die Küken, verstärkte Freizeitnutzung ihrer Lebensräume durch Menschen und die intensive Landwirtschaft, die ihre Lebensräume beeinflusst. Auch das Schließen offener Mülldeponien und Veränderungen in der Fischerei spielen eine Rolle. Im Jahr 2023 wurden Lachmöwen von der Vogelgrippe heimgesucht und viele Brutgebiete ganz aufgegeben.
Trotzdem gilt die Lachmöwe weltweit aktuell noch nicht als gefährdet. Forschende erwarten jedoch, dass sich ihr Verbreitungsgebiet durch den Klimawandel deutlich verschieben und in Westeuropa schrumpfen könnte.
Die Lachmöwe ist zwar eine echte Überlebenskünstlerin, aber eine, die sich in Zukunft noch weiter anpassen muss, um geeignete Bedingungen zu finden.
Hast du was Neues über die Lachmöwe erfahren oder einen andere tolle Lachmöwen-Geschichte erlebt, die du mit mir teilen magst? Erzähl mir gerne unten in den Kommentaren davon.



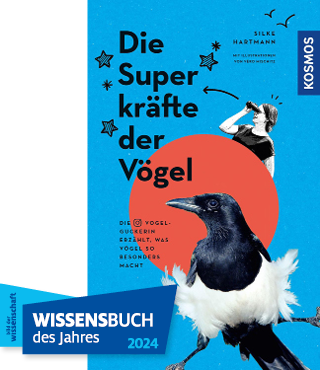
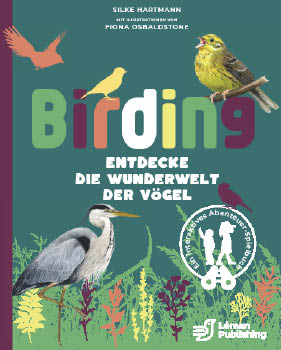
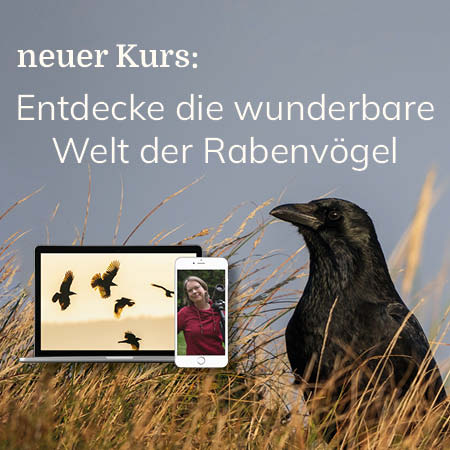








0 Kommentare