Wenn es eine Vogelart gibt, bei der sich die Geister scheiden, dann ist es wohl die Elster. Die einen lieben sie für ihr elegantes Schwarz-Weiß, ihre Klugheit und ihr neugieriges Wesen. Die anderen sehen in ihr eine dreiste Nesträuberin, die Singvögel bedroht, furchtbar nervt und sich hemmungslos an allem bedient, was glänzt. Kaum ein Vogel ist mit so vielen Vorurteilen beladen wie sie.
Und obwohl sie so leicht zu beobachten sind, werden sie oft übersehen und nicht richtig wahrgenommen. Dabei gibt es da so viel zu entdecken! Und deshalb schauen wir uns die Elster jetzt mal genauer an. Hier erfährst du, was an den Gerüchten über glänzende Objekte und Singvogelnester wirklich dran ist, ob sie so klug sind wie andere Rabenvögel und warum sie sich zu Banden zusammenschließen.
Weil die Elster so cool ist, habe ich ihr gleich zwei Podcast-Folgen gewidmet.
>>> Hier kannst du sie kostenlos anhören.
Aussehen
Du erkennst sie sofort und glaubst bestimmt auch, sie längst zu kennen: Elstern haben ein schwarz-weißes und dadurch extrem kontrastreiches Gefieder und einen langen Schwanz. Das Schwarz auf den Flügeln und am Schwanz kann, je nachdem wie das Licht daraufscheint, metallisch grün, blau und violett schillern. Das ist sehr schick!
Dieses Schillern oder Schimmern führt auch dazu, dass mir von Einsteiger*innen manchmal blau(!)-weiße Vögel mit einem langen Schwanz gemeldet werden. Bei denen handelt es sich höchstwahrscheinlich um Elstern. Solch ein schönes Aussehen wird ihnen offenbar nicht zugetraut. Es lohnt sich also, Elstern auch optisch besser kennenzulernen!
Entdecke die faszinierende Welt der Rabenvögel!
Der zweiwöchige Onlinekurs über die cleversten Vögel Europas – für Vogelfans, die mehr wissen, verstehen und staunen wollen.
>>> Jetzt auf die Warteliste eintragen <<<
Vorurteile
Über kaum einen anderen Vogel gibt es wohl so viele Vorurteile wie über Elstern. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an: Angeblich sind sie nämlich böse. Und diebisch natürlich sowieso. Auch sollen sie von Glitzerndem magisch angezogen werden und hinterlistigerweise süße kleine Küken rauben. Überall breit macht sie sich angeblich auch und dann lacht die auch noch so laut und heimtückisch.
Aber ist an all diesen Vorurteilen was dran?
Sind Elstern diebisch?
Elstern tagen den Beinamen „diebisch“. Das kommt von der Vorstellung, dass sie fasziniert von glänzende, glitzernden Gegenstände seien und diese dann mit sich nähmen. Besonders interessant sollen für Elstern angeblich rundliche, silbrig glänzende Gegenstände wie Münzen oder Schmuckstücke sein, die sie einzeln unter ein wenig Laub oder Gras verstecken oder mit in ihr Nest nehmen und dort horten. Warum auch immer.
Es gibt sogar eine Oper von Rossini, die La gazza ladra heißt („Die diebische Elster“, uraufgeführt 1817). Darin stiehlt eine Elster ein Goldstück und verhindert so eine Exekution. Das klingt doch eigentlich ganz positiv. Wurde ihr aber natürlich nicht positiv ausgelegt.
Eine wissenschaftliche Untersuchung zu dem Thema kommt jedoch zu dem Schluss, dass Elstern keine generelle Vorliebe für glänzende Objekte haben. Den Ruf, bestimmte Objekte auch zu stehlen, verdanken sie vermutlich dem Umstand, dass sie manchmal beim Verstecken von Nahrungsvorräten beobachtet werden können, oder dass der Mensch gerne von sich auf anders schließt.

Sind Elstern Nesträuberinnen?
Ja, Elstern sind Nesträuberinnen: Sie mopsen Eier und Küken aus den Nestern kleinerer Vögel. Aber das tun viele andere Vögel und Säugetiere, wie Eichhörnchen, Kohlmeisen oder Amseln, auch. Nur Elstern sind so schön groß, auffällig und sichtbar, dass sogar wir Dully Menschen mitbekommen, wenn sie Nester ausräumen. Küken und Eier machen aber zur Brutzeit nur drei bis sechs Prozent ihrer Nahrung aus. Das ist guter Vogeldurchschnitt, denn schließlich sind Eier im Frühling für viele Tiere eine willkommene Proteinquelle.
Außerdem hat alles in der Natur mindestens zwei Seiten.
Auch die Nester von Elstern werden ausgeräumt. Ich konnte einmal selbst beobachten, wie sich eine Rabenkrähe in unserem Garten einem Elsternnest näherte und vom lauten Protest und den Scheinangriffen des Elsternpaares vertrieben wurde – nur um sich dann später doch noch ein Ei schnappen zu können.
Wichtig dabei ist auch: In der Natur gelten nicht dieselben moralischen Regeln, wie noch in weiten Teilen unserer von Supermärkten durchzogenen menschlichen Gesellschaft, in der wir die Aufzucht und das Töten unserer tierischen Nahrung anderen überlassen und hinter fensterlosen Mauern verstecken.
Die Verluste durch Elstern und andere natürlich vorkommende „Nesträuber“ sind nicht bestandsgefährdend! Besonders bei den kleineren Singvögeln sind sie von Natur aus mit einkalkuliert. So brüten beispielsweise Blaumeisen mehrmals im Jahr und legen dabei bis zu 17 Eier, eben weil nicht alle Küken überleben werden. Die Verluste durch satte Stubentiger mit Jagdinstinkt (aka: Katzen) hingegen sind nicht mit einkalkuliert.
Elstern sind nicht schuld daran, wenn weniger Amseln oder Meisen zu sehen sind. Viel entscheidender für den Rückgang vieler Arten sind menschgemachte Faktoren wie Lebensraumverluste, das Verschwinden ihrer Nahrung und der Einsatz von Pestiziden.
Nehmen die Elsternbestände immer weiter zu?
Nein, ganz im Gegenteil. Wie viele Vogelarten finden Elstern in ihrem eigentlichen Lebensraum auf den Feldern durch die Verarmung der Agrarlandschaft immer weniger Nahrung. Auf dem Land sind sie außerdem bedroht durch die menschliche Jagd. So konzentriert sich die Elstern-Population inzwischen auf menschliche Siedlungen. Da sie größer, präsenter, lauter und sozial sind, bemerken wir sie dort leichter als eine Heckenbraunelle oder ein Wintergoldhähnchen. Außerhalb von Städten nimmt die Anzahl der Elstern jedoch immer weiter ab.
Sind Elstern intelligent?
Elstern gehören zu den intelligentesten Vögeln, und es wird angenommen, dass sie eines der intelligentesten nichtmenschlichen Lebewesen überhaupt sind. Der Bereich, der bei Vögeln für komplexere Denkleistungen wie Planen oder Probleme lösen zuständig ist (das sogenannte Nidopallium), ist bei Elstern im Verhältnis zu ihrer Körpergröße ungefähr genauso groß wie der funktional entsprechende Bereich bei Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und auch bei uns Menschen.
Sie entwickeln früh Objektpermanenz, das heißt, sie verstehen, dass ein Objekt noch da ist, auch wenn sie es nicht mehr sehen können. Außerdem ist die Elster eines der wenigen bekannten Tiere, die den Spiegeltest bestehen.
Der sogenannte Spiegeltest ist ein Versuch aus der Verhaltensforschung, bei dem geprüft wird, ob ein Tier sich selbst im Spiegel erkennen kann. Dabei bekommt das Tier eine Markierung an eine Stelle, die es ohne Spiegel gar nicht sehen könnte – zum Beispiel am Hals oder auf der Stirn. Dann stellt man ihm einen Spiegel hin und schaut: Reagiert es auf die Markierung? Versucht es vielleicht, sie wegzuwischen? Dann wäre das ein Hinweis darauf, dass das Tier verstanden hat: „Das da im Spiegel bin ich – und nicht ein anderer.“
Und Selbsterkenntnis ist ja bekanntlich nicht nur der erste Schritt zur Besserung, sondern erscheint vielen auch als ein Zeichen von Intelligenz.
Elstern checken also nicht nur, dass sie selbst das im Spiegel sind und zeigen somit ein Bewusstsein für sich und den eigenen Körper, sie verstehen auch, dass sich alles im Spiegel spiegelt und verarbeiten diese Informationen entsprechend. Sie suchen also beispielsweise nicht im Spiegel nach etwas, das versteckt wurde, sondern hinter sich.
Dass die Elster den Spiegeltest besteht und sich selbst im Spiegel erkennt, zeigt auch, dass sie auf eine ähnliche Art intelligent ist, wie wir Menschen das verstehen können und bei uns als „intelligent“ definieren.

Lebensraum & Verbreitung
Elstern sind in ganz Deutschland zu Hause – und nicht nur hier. Ihre Verbreitung reicht vom Nordkap bis an die Südspitzen von Portugal und Spanien, von Irland bis hinüber nach Vietnam, also von Westeuropa bis nach Asien. Auf der Kamtschatka-Halbinsel gibt es auch noch mal eine isolierte Population. Selbst in Teilen Nordafrikas und des Nahen Ostens sind sie zu finden.
Elstern sind Rabenvögel, gehören zur Gattung der echten Elstern. Darin gibt es vier Arten, die sich alle extrem ähnlichsehen. So ähnlich, dass zwei von ihnen lange als Unterarten unsere Elster betrachtet wurden. Nämlich die Koreanische Elster (Pica serica) und die Hudsonelster (Pica hudsonia), von der haben wir in der letzten Folge schon mal kurz gesprochen. Außerdem gibt es noch die Gelbschnabelelster (Pica nuttalli) und natürlich DIE Elster, unsere Elster (Pica pica) mit etlichen Unterarten, weil sie so weit verbreitet ist.
Bei ihrem Lebensraum ist unsere Elster extrem anpassungsfähig. Sie kommt sowohl im Flachland wie im Gebirge vor und kommt in offenen Landschaften genauso gut klar wie in städtischen Gegenden. Wichtig ist ihr nur eines: ein bisschen Struktur. Das heißt, Elstern mögen es gern abwechslungsreich: mit ein paar Bäumen oder Büschen zum Brüten, offenen Flächen zum Suchen und Finden von Nahrung.
Früher waren Elstern eher Vögel der Feld- und Waldränder, des Offenlands, der Agrarlandschaft. Doch Schätzungen zufolge brütet inzwischen mehr als die Hälfte des Bestandes in Europa in und am Rand von bebauten Bereichen. Sie besiedelt insbesondere Einfamilienhausbereiche mit kurz geschnittenen Rasenflächen, daneben Parkanlagen, Alleen, Friedhöfe und große Hausgärten. Dort profitieren sie vom ganzjährigen Nahrungsangebot, von Futterhäuschen und den höheren Temperaturen im Winter.
Wie alle Vogelarten, die in den Siedlungen leben, verhalten sich Elstern dort oft anders als auf dem Land. Sie sind zum Beispiel deutlich weniger scheu, manchmal sogar richtig neugierig. Und natürlich nutzen sie ganz selbstverständlich menschgemachte Strukturen wie Laternen, Straßenschilder oder Hausdächer als Aussichtspunkte.
Wenn du also in einer Wohnsiedlung, auf einem Friedhof oder im Park unterwegs bist, schau dich mal um: Die Chancen stehen gut, dass irgendwo eine Elster sitzt.

Verhalten & Lebensweise
Gemeinschaft
Elstern sind keine Einzelgängerinnen. Ganz im Gegenteil: Sie führen ein erstaunlich komplexes Sozialleben. Sie sind ziemlich gesellig und leben oft in kleinen Gruppen oder lockeren Familienverbänden von einem Dutzend bis zu einigen hundert Vögeln, vor allem außerhalb der Brutzeit. Das hat den Vorteil, dass sie sich gegenseitig vor Gefahren warnen und gemeinsam Futter suchen können.
Außerdem gilt das Motto: Gemeinsam sind wir stark. Größere Nichtbrütergemeinschaften können Nahrungsquellen länger verteidigen und sich zum Beispiel gegen Raben- und Nebelkrähen durchsetzen. Sie gehen auch schon mal auf Möwen, Raben, Eulen, Mäusebussarde oder auch Eichhörnchen los und vertreiben sie.
Brutzeit
In der Brutzeit leben Brutpaare allein in ihren Revieren, während sich Nichtbrüter (also junge Elstern, die noch kein eigenes Revier haben) zu Gruppen zusammenschließen. Die Paare bleiben in der Regel lebenslang zusammen und kümmern sich gemeinsam um den Nestbau, um die Verteidigung des Reviers sowie ums Brüten und Füttern und Aufziehen der Jungen. Stirbt einer der Partner, ersetzt ihn der andere meistens schnell durch einen einjährigen Vogel. Wiederholen sich erfolglose Bruten zu häufig, trennen sich Paare in der Regel auch.
Die Reviere können je nach Umgebung mehrere Hektar groß sein. Innerhalb dieses Gebiets bauen die Elstern ihr Nest meist hoch oben in Bäumen oder dichten Hecken, manchmal sogar in Gebäudenischen oder auf Hochspannungsmasten.
Das Nest ist eine Meisterleistung. Sie bauen eine kugelförmige Konstruktion aus Zweigen, Wurzeln und Ästen. Der äußere Bereich besteht aus sperrigen, trockenen, sich oft kreuzenden, nach außen abstehenden Zweigen. Die Nistmulde ist aus feinem Wurzelwerk geflochten. Die meisten Nester haben einen haubenartigen Überbau mit einem, oft auch zwei seitlichen Ausgängen. Diese „Dachkonstruktion“ soll das Gelege vor Krähen oder Greifvögeln schützen – eine ganz schön clevere Konstruktion.
Elstern beginnen häufig an mehreren Stellen Nestern. Deshalb scheint es so, als gäbe es viel mehr Elstern als es tatsächlich der Fall ist. Am Ende nutzen sie häufig ihre alten Nester wieder. Die Gesamtzeit für den Nestbau beträgt im Schnitt 40 Tage. Beide Brutpartner beteiligen sich daran.
Revierverhalten
Elstern sind standorttreue Vögel. Die Brutpaare überwachen ihr Revier ganzjährig, selbst dann, wenn sie sich im Winter zum Schlafen teilweise den Nichtbrütergemeinschaften anschließen. Und das ist auch wichtig, denn neue Vogelpaare versuchen ab Spätherbst, sich ein Revier zu erobern. Dazu verbündet sich eine kleine Gruppe von Nichtbrütern und dringt in ein bestehendes Revier ein. Normalerweise gelingt es dem revierbesitzenden Männchen, die Eindringlinge zu vertreiben. Scheitert es jedoch, so übernimmt der dominanteste Jungvogel, der meist auch Initiator des Einfalls ist, mit seiner Partnerin das Revier.
Ernährung
In den menschlichen Siedlungen haben die Elstern ihre Nahrung angepasst. Sie fressen hier vermehrt auch Essensreste, tierische Verkehrsopfer, Katzenfutter, und natürlich die Snackbar am Futternhäuschen. Ihr Speiseplan ist aber auch grundsätzlich sehr abwechslungsreich. Sie fressen das ganze Jahr über sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung wie Larven, Schnecken, Würmer, Amphibien, Früchte, Pilze, Sämereien. Sie suchen meist am Boden danach. Dabei kannst du sie auch erhaben durch deinen Garten schreiten sehen.
Stimme & Gesang
Da Elstern so sozial sind, haben sie eine komplexe Kommunikation. Das, was wir häufig hören, ist ihr Schackern: Das sind schnell aufeinander folgende Rufe, die als Warn- und Alarmruf dienen. Revierinhabende Vögel nutzen es zur Verteidigung des Reviers. Nichtbrütende Elstern gebrauchen es, wenn Gefahr droht.
Aber Elstern können noch mehr, schließlich gehören sie zu den Singvögeln. Sie verfügen über ein großes Repertoire an Lauten und können wohl auch mal Geräusche anderer Tiere oder Umweltgeräusche nachahmen.
Was wir meist gar nicht mitbekommen ist ihr Gesang, den sie zur Festigung der Partnerschaft nutzen. Es ist eher ein leiser Plaudergesang, der sehr individuell ist und sich von Elster zu Elster stark unterscheidet. Mal ist er rhythmisch, mal arhythmisch, oft sind weiche Trillerlaute und hohes Pfeifen darin enthalten. Meist besteht der Gesang aus einem gurgelnden, bauchrednerischen Schwätzen mit Pfeiflauten.
Mensch & Elster
Die Elster hat einen festen Platz in den Geschichten der Menschen. Im von der nordischen Mythologie geprägten Volksglauben galt die Elster als Bote der Todesgöttin Hel, so dass sie in Europa den Ruf der Unheilsbotin bekam. Im Mittelalter galt sie als Hexentier und Galgenvogel. In quasi jeder Region gibt es einen eigenen Glauben, was eine Elster generell, eine schackernde Elster auf dem Dach oder eine auf einen zufliegende Elster bedeuten. Und überall ist man sich einig: nichts Gutes. Zank, Streit, Feuersbrunst, eine bevorstehende Beerdigung, Viehsterben, langweiliger Besuch oder der Besuch des Amtsknechtes – you name it. Die kreative Unglücksliste ist lang und die Elster angeblich an vielem Schuld. Mancherorts gilt sie auch als verwandelte Hexe, an anderen hilft ihr zu Pulver zermahlener Körper gegen Schwindsucht oder Fieber. Andererseits kann ihre Anwesenheit auch gegen Warzen oder Hühneraugen helfen.
Im Gegensatz dazu gilt sie in China und Japan traditionell als Glücksbotin, die insbesondere ein freudiges Ereignis, meist eine Geburt oder einen Besuch, ankündigt. Die nordamerikanische Hudsonelster ist bei einigen indigenen Völkern Nordamerikas ein Geistwesen, das mit den Menschen befreundet ist.
In ganz Europa werden Elstern bejagt. Jagende steuen weiterhin die alte Mär, dass Elstern einen negativen Einfluss auf Nutztieren und kleinere Singvögel und Säugetiere haben sollen. Allerdings konnte ein solcher negativer Einfluss in unzähligen Studien nicht nachgewiesen werden. Trotzdem werden nach offiziellen Angeben in Europa jährlich knapp eine Millionen Elstern getötet – was mal eben so mehr als der Gesamtbestand aller deutscher Elstern zusammen ist.

Die Namen der Elster
Es gibt im Deutschen viele Namen für die Elster. Ursprünglich hieß sie im althochdeutschen wohl mal agalstra. Daraus wurde unter anderem Agasta, Ekster, Haster, Heisker, Hutsche, Jängster, Tratschkatel, Tschaderer, Gartenrabe, Schalester, Scholaster oder auch Alster.
Im Englischen heißt sie magpie. Die erste Silbe mag ist wohl eine Abkürzung für Margaret und wurde als Spitzname für eine geschwätzige Person verwendet. Es spielt aber sicher auch auf das Schäckern (im Englischen: „mag-mag-mag“) des Vogels an. Die zweite Silbe -pie kommt wahrscheinlich vom lateinischen Namen der Elster: Pica pica.
Diesen Bestandteil gibt es auch im Französischen. Da heißt die Elster pie bavarde. Pie kommt wieder von Pica pica, und das zweite Wort (bavarde) heißt Klatschbase, Tratschtante. Das lasse ich mal hier so stehen, aber hier ein paar spannende Beiträge, die den Zusammenhang zwischen der Abwertung der weiblichen Kommunikation und der Macht des Patriarchats und des Kapitalismus erklären:
- Helena, @h_lenah: Die Dämonisierung von Gossip (Video) (19.05.2024, tiktok)
- Tara-Louise Wittwer, @wastarasagt: Mythen & Misogynie (Video) (14.01.2025, instagram)
- Paul Wolf: Geschichte der Misogynie II: Hexenverfolgungen und die Frage „Was ist eine Frau?“ (Kritischer Kalender)
- Lisa Bullerdiek: Warum wir öfter lästern sollten (23.04.2023, Krautreporter)
Die Elster in der Kultur
In alten Geschichten, Märchen und Fabeln taucht die Elster immer wieder als listige Figur auf, die mit viel Grips durchs Leben geht. Diese Mischung aus Respekt und Abneigung zieht sich bis heute durch viele Darstellungen – von Märchen über Sprichwörter bis hin zu Kinderbüchern.
Für viele Menschen im deutschsprachigen Raum hat die Elster ein besonders sympathisches Gesicht: Frau Elster aus dem DDR-Kinderfernsehen. Im „Abendgruß“ des Sandmännchens war sie jahrzehntelang die ordnungsliebende, leicht besserwisserische Nachbarin von Herrn Fuchs und wurde so zu einer echten Kultfigur. Viele erinnern sich bis heute an ihre krächzende Stimme, ihren Regenschirm und ihre liebevoll altmodische Art. Wer mit Frau Elster aufgewachsen ist, verbindet mit der Elster also hoffentlich weniger eine Diebin, sondern eher eine selbstbewusste, liebenswerte Dame mit Prinzipien.
Fazit
Die Beziehung zwischen Elstern und uns Menschen ist also … sagen wir mal: kompliziert. Allerdings nur aus von unserer Seite aus. Einerseits sind sie allgegenwärtig, leicht zu erkennen und durch ihre Klugheit faszinierend. Andererseits haftet ihnen zu Unrecht ein ziemlich schlechter Ruf an.
Wenn wir einmal drauf achten, sind Elstern überall um uns zu entdecken. Und genau das bringt uns in eine besondere Position: Wir können lernen, sie zu beobachten, statt sie vorschnell zu verurteilen. Wer sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und einer Elster beim Suchen, Klettern, Balancieren oder sogar beim Spielen zuschaut, merkt schnell: Diese Vögel haben Persönlichkeit. Und vielleicht sind sie gerade deshalb so polarisierend, weil sie uns ein kleines bisschen ähnlich sind: neugierig, selbstbewusst, laut, erfinderisch, klug, vorwitzig und ziemlich erfolgreich.
Und wenn du noch nicht genug von Rabenvögeln bekommen kannst, komm in den brandneuen Rabenvögel-Kurs und entdecke zwei Wochen lang die faszinierende Welt der cleversten Vögel Europas, ganz gemütlich von deinem Sofa, deiner Strandliege oder deinem Küchentisch aus.



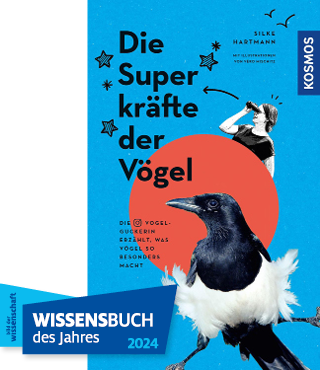
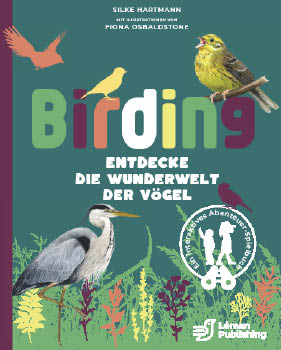
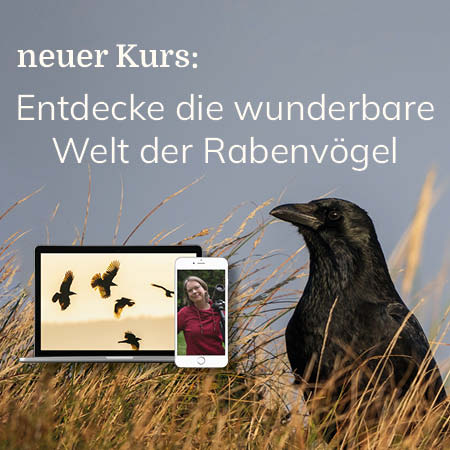








Liebe Silke,
Danke für diesen informativen Blogartikel! Seit wir bei uns vor dem Haus ein Elsternpaar haben bin ich voll Fan von diesen Vögeln geworden. Darum war das gerade sehr spannend für mich.
Liebe Grüsse,
Edith
Hallo, liebe Edith,
das freut mich sehr! Vielen Dank für deine schöne Rückmeldung und weiterhin viel Spaß beim Beobachten „deiner“ Elstern.
Herzliche Grüße
Silke
http://www.youtube.com/watch?v=_fPbWEa1cyg&list=RD_fPbWEa1cyg&start_radio=1
kennst du wahrscheinlich schon
Lieben Gruß